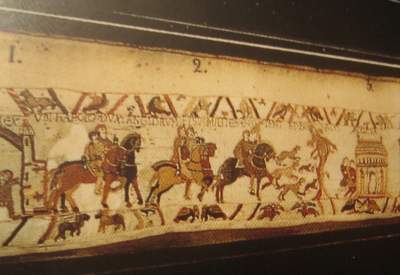Nummerierung der Fiaker, Wien 1756
Laut Historischem Lexikon der Stadt Wien wurden die Wiener Fiaker 1800 nummeriert; aus einem Akt des Wiener Stadt- und Landesarchiv geht allerdings hervor, dass dies schon fast 50 Jahre früher der Fall war: Demnach sei über einen Vortrag vom 8. Mai 1756 eine allerhöchste Resolution ergangen daß um dem Muthwilligen schnellen Fahren deren Lehenkutschern dereinst gemessenen Einhalt zu verschaffen, die Stadt- so wie die Vorstadt-Lehen-Wagen ohne Ausnahme auf der Seite mit ordentlichen Numeren bemerket sofort und da aus diesen Zaichen bey Ausübung einigen Muthwillens die Innhaber deren Wägen füglich zu erkennen seynd, die in derley schnellen Fahren immer wo betrettende Lehen- und andere Kutscher zum erspieglenden Beyspiel für die übrige auf das empfindlichste in instanti gezüchtiget werden sollten. Was diese Nummerierung betreffe, sei alles nötige durch den Verwalter des Großen Armenhaus in die Wege zu leiten. Weiters solle ein gedruckter öffentlicher Ruff ausgehängt werden, der alle und jede Lehen- und andere Kutscher auffordere, von allem schnellen Fahren sich also gewis [zu] enthalten (...), wie im widrigen die jenigem welche darinne betretten werden, zum erspieglenden Beyspil für die übrige auf das empfindlichste an dem Orth des verübten Muthwillens gezüchtiget, und nicht allein durch die Polizey-Wacht, sondern auch so gar durch die patroulirende Miliz alsogleich von dem Wagen herab genohmen, und mit gemessenen Stockstreichen abgestraffet, allenfalls nach Maaß ihrer Bosheit, und des dabey begangenen Verbrechens zu fernerer Bestraffung arrestirlich angehalten werden würden.
WSTLA, Alte Registratur, A1 - Zusammengelegte Akten, 180 ex 1755: Niederösterreichische Repräsentation und Kammer an die von Wien, 10.5.1756; Ruff (gedruckt), 14.5.1756.
Art. Fiaker, in: CZEIKE, Felix (Hg.): Historisches Lexikon Wien in fünf Bänden. Bd. 2. Wien: Kremayr & Scheriau, 1999, S. 294f.
WSTLA, Alte Registratur, A1 - Zusammengelegte Akten, 180 ex 1755: Niederösterreichische Repräsentation und Kammer an die von Wien, 10.5.1756; Ruff (gedruckt), 14.5.1756.
Art. Fiaker, in: CZEIKE, Felix (Hg.): Historisches Lexikon Wien in fünf Bänden. Bd. 2. Wien: Kremayr & Scheriau, 1999, S. 294f.
adresscomptoir -
Nummerierung - So, 21. Okt. 2007, 13:00