Band "Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie" erschienen
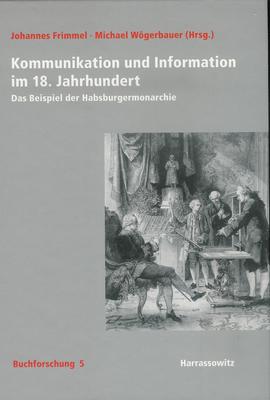 Der Band zur Tagung von 2007 flatterte gestern in den Briefkasten, so interessant er ist, ein Schnäppchen kann man ihn wohl nicht nennen:
Der Band zur Tagung von 2007 flatterte gestern in den Briefkasten, so interessant er ist, ein Schnäppchen kann man ihn wohl nicht nennen:Frimmel, Johannes/Wögerbauer, Michael (Hg.): Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie. (=Buchforschung. Beiträge zum Buchwesen in Österreich; 5). Wiesbaden: Harrassowitz, 2009. 404 S., ISBN 978-3-447-05918-3, 80,20 Euro [A], Verlags-Info
Mein Beitrag darin zu den habsburgischen Fragämtern ist die leicht aktualisierte Fassung zu der in den Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung 2007-2 in Österreich (vgl. hier) erschienenen; der Ankündigungstext des Bands lautet:
Im Europa des 18. bis 20. Jahrhunderts nimmt die Habsburgermonarchie eine besondere Stellung ein. Unter einer Herrschaft lebten verschiedene Nationen und Ethnien zusammen, mit ihren verschiedenen Sprachen, Religionen und kulturellen Traditionen. Im 18. Jahrhundert veranlasste der absolutistische Staat eine Reihe von Maßnahmen, um das Herrschaftsgebiet zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Die Förderung des Buchwesens war ein wichtiger Bestandteil dieses von Ernst Wangermann als "Austrian Achievement" bezeichneten Reformprogramms. Innerhalb weniger Jahrzehnte vervielfachte sich die Anzahl der Firmen und die Buchproduktion. Die Erforschung dieses Buchwesens, das Information, Wissen und Bildung überwiegend vermittelte, stand im Mittelpunkt der Wiener Tagung "Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburgermonarchie", deren Beiträge hier gesammelt vorliegen. Ein Schwerpunkt des Bandes liegt auf dem vielsprachigen und transnationalen Charakter der habsburgischen Buchgeschichte.
Inhaltsverzeichnis:
Wolfgang Schmale (Wien): Geleitwort (9-11)
Johannes Frimmel (Wien), Michael Wögerbauer (Prag): Einleitung (13-19)
Moritz Csáky (Wien): Kommunikation, Information, Kultur (21-30)
I. Buchproduktion und Kulturtransfer
Frédéric Barbier (Paris): Buchhandelsbeziehungen zwischen Wien und Paris zur Zeit der Aufklärung (31-44)
Anja Dular (Ljubljana): Johann Thomas Edler von Trattner (1719–1798) and the Slovene Book Market of the 18th Century (45-54)
Hans Joachim Kertscher (Halle): Die Beziehungen der Halleschen Verlage Gebauer und Schwetschke zu Verlagen und Buchhandlungen der Habsburgermonarchie (55-64)
Gertraud Marinelli-König (Wien): Franz Sartoris Historisch-ethnographische Übersicht der wissenschaftlichen Cultur […] des österreichischen Kaiserthums (1830) revisited: Kolonisierung / Integrierung der neuen südlichen und östlichen Gebietsgewinne (65-75)
Geoffrey Roper (London): The Vienna Arabic Psalter of 1792 and the rôle of typography in European-Arab relations in the 18th century and earlier (77-89)
Orlin Sabev (Sofia): Political and Mental Borders: Austrian-Ottoman Relations in the First Half of the Eighteenth Century and the First Ottoman-Turkish Printing Press (91-99)
II. Buchkauf und Literaturrezeption
Franz M. Eybl (Wien): Nordböhmische Spurensuche. Was ein Bibliothekskatalog über barocke Textzirkulation erzählt (101-118)
Ilona Pavercsik (Budapest): Bücherverkauf in einer Pester Buchhandlung 1786–1787: Veränderte sich tatsächlich der Lesergeschmack? (119-130)
Jiří Pokorný (Prag): Die Literaturproduktion in Böhmen im 18. Jahrhundert und die Stellung der tschechischen Literatur in den Bibliotheken Prager Bürger (131-139)
III. Verlagsbuchhandel: Organisation und Netzwerke
Andreas Golob (Graz): Buchvertriebsnetze in der Habsburgermonarchie am Ausklang des 18. Jahrhunderts. Das Beispiel der steiermärkischen Akteure (141-151)
Ernst Grabovszki (Wien): Der Buchhändler als Rechtssubjekt (153-161)
Olga Granasztói (Budapest): La librairie viennoise et l’approvisionnement de la Hongrie en livres français, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle (163-172)
Claire Mádl (Prag) : L’aristocrate client, complice et concurrent des libraires. Quelques traits de l’approvisionnement des bibliothèques nobiliaires de Bohême dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (173-187)
Júlia Papp (Budapest): Relations between illustrators and publishers in Vienna at the turn of the 19th century as mirrored in the works of Johann Blaschke (1770–1833) (189-200)
IV. Klandestinität
Norbert Bachleitner (Wien): Von Teufeln und Selbstmördern. Die Mariatheresianische Bücherzensur als Instrument der Psychohygiene und Sozialdisziplinierung (201-215)
Hellmut G. Haasis (Reutlingen): Literarischer Underground Habsburg 1700–1800 (217-226)
Christine Haug (München): „In Frankreich nach Erscheinen verboten, sehr rar“– Zu den Distributions- und Vermarktungsstrategien von Geheimliteratur in der Habsburgermonarchie zur Zeit der Aufklärung (227-244)
Judit Vizkelety-Ecsedy (Budapest): Statt Zensur – falsche und fingierte Druckorte (245-253)
Dietmar Weikl (Wien): Das Buch im Geheimprotestantismus (255-263)
V. „Aufklärung“ des „Volks“
Louise Hecht (Wien): ‚Um die Judenschaft in Böhmen [...] der bürgerlichen Bestimmung immer näher zu bringen‘. Jüdische Schulen und Schulbücher in Böhmen (265-279)
Eduard Maur (Prag): Informations-Sedimente. Ursprung und Wandel von politischen Informationen in böhmischen Chroniken um 1800 (281-290)
Reinhart Siegert (Freiburg): Zur Physiognomie der Habsburgermonarchie innerhalb der Volksaufklärung in Mitteleuropa (291-307)
Anton Tantner (Wien): Frag- und Kundschaftsämter in der Habsburgermonarchie als Institutionen der Informations- und Wissensvermittlung (309-320)
VI. Periodika als Medien der Wissensvermittlung
Ágoston Zénó Bernád (Wien): Wissensvermittlung zur Ehre der Nation. Das Programm des Ungrischen Magazins und die Informationsvermittlung über Siebenbürgen am Beispiel der Beiträge des Johann Seivert (321-330)
Annamária Biró (Cluj): Die Siebenbürgische Quartalschrift (1790–1801) als Medium der drei Nationen Siebenbürgens (331-340)
Romana Filzmoser (Wien): „Schönheit und Quark – Quark auf Schönheit“. Der Wiener Neuesten Mode Allmanach und Marriage A-La-Mode (341-356)
Helga Meise (Reims): Kommunikation und Information im urbanen Raum: Die Prager Moralischen Wochenschriften 1771–1785 (357-370)
Andrea Seidler (Wien): Wien als Ausgangspunkt des ungarischen gelehrten Journalismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (371-380)
Jozef Tancer (Bratislava): Die Pressburger Moralischen Wochenschriften als Literaturvermittler (381-389)
Alfred Stefan Weiß (Salzburg): Medizinische Wissensvermittlung durch Rezensionen am Beispiel der Medicinisch-chirurgischen Zeitung 1790–1808 (391-401)
#FragamtWien
adresscomptoir -
Communication - Di, 22. Sep. 2009, 08:38








